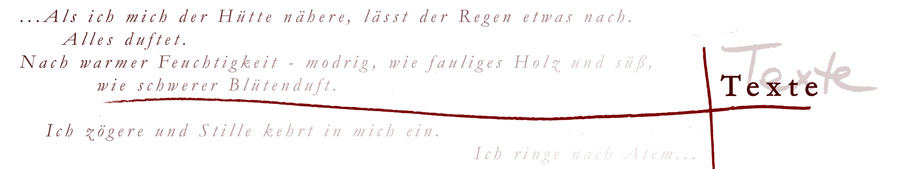rato
Roman, 130 Seiten; 2007
Teil des Diplom-Projektes „rato“; 07/2007
Selbstverlag (1.Auflage 200 Exemplare), verfügbar als Taschenbuch
Leseprobe: (Prolog)
Am Abend des 14. Juni 2007 saß ich noch nicht lang im Gasthaus „Arche Noah“ in der Erfurter Altstadt, als sich ein groß gewachsener Mann an meinem Tisch niederlassen wollte. „Ist hier noch frei?“ Er trug eine weite, dunkelgraue Hose, ein verschlissenes, blaues Hemd an dem einige Knöpfe fehlten und um seinen Hals fiel mir eine ovale Steinperle auf. Er hatte struppig geschorenes Haar und Bart. Auf Nase, Wangen und Lippen schälten sich kleine, papierartige Hautfetzen ab und hinterließen rötlich transparente Stellen neu gewachsener Epidermis, die, umgeben von fester, lederbrauner Haut, seltsam nackt und verletzlich erschienen. Er schien auf den ersten Blick sehr müde und verbraucht zu sein. Der Kopf senkte sich etwas, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Etwas an ihm war sehr irritierend. Sein Blick. Seine Augen flackerten wie unsichtbares Feuer. Nicht grau, nicht blau – fast weiß die Iris und Abgründe in den Pupillen. Als ob die einstmals wohl blaue Farbe von zu intensivem Licht, von zu heftigem Sehen ausgeblichen wäre, wie verwitternde Knochen in der Wüste. Doch weder sengende Hitze strahlten sie aus noch Kälte. Eher etwas von kristallartiger Klarheit. Er schaute kurz im Raum umher, alles mit den Augen abtastend, wie mir schien. Schwer senkte er erneut den Kopf. Unauffällig beobachte ich ihn von der Seite. Er ignorierte mich völlig. Er sprach kein weiteres Wort zu mir, lächelte immerwährend, kaum merklich in sich hinein und bestellte ein großes Guinnes. Er starrte in das schwarze Gebräu. Träge sackten seine Lider herab, so dass nunmehr kaum noch etwas von den seltsamen Augenlichtern zu sehen war. Fahle Mattigkeit und taube Müdigkeit ließen seine Erscheinung verblassen und erschöpften meine Neugier. Wie oft hatte ich schon in dieser Kneipe gesessen? Gesichter von alten Freunden stiegen in mir auf. Erinnerungen. Wohlig lösten sie sich im Klimpern der Gläser auf und verschwanden vollends im warmen Beginn eines viel versprechenden Kneipenabends - allein mit meinen noch ungeborenen Ideen. Blues. Ich erkannte Neil Young in meinem Ohr.
Nach einer Weile holte mein schweigsamer Tischnachbar ein kleines, abgegriffenes Buch aus seiner Tasche, einer grünlichen Umhängetasche, und begann darin zu blättern. Er zog einen Bleistift aus dem Buchrücken und fing zu schreiben an. Ich sah ihm nebenbei zu. Das fesselnde Gefühl jemanden unbemerkt bei einer ganz persönlichen Beschäftigung beobachten zu können. Angespannte Falten intimer Konzentration und zuckende Mundwinkel von unergründlicher Bedeutung. Dort gab es etwas Wichtiges. Ich wurde neugierig und verfolgte ihn nun intensiver. Er biss sich auf die Zunge, verzog die Augen zu Schlitzen. Nur um sie im nächsten Moment bedrohlich aufzureißen wie ein aggressives Tier. Augenblicke später bemerkte ich, dass die kreisenden Bewegungen des sichtbaren Stiftendes nicht auf Schreiben sondern auf Zeichnen hindeuteten. Wie von einem Traum besessen, zerrten seine Finger hektisch den zerkauten Bleistift über die Seiten. Dabei starrte er auf sein Buch, als hätte er einen großen, mächtigen Gegner vor sich, den es gleichzeitig zu bezwingen, wie zu beleben galt.
Ich kannte dieses Gefühl, wenn in der leeren, weißen Fläche des Papiers etwas nach mir zu rufen schien. Alles andere, die Kneipe, die Musik, den Zigarettenqualm und das brodelnde Murmeln der Stimmen schien er nicht mehr zu beachten. Auch mich, der ihn unverhohlen beobachtete, nahm er scheinbar überhaupt nicht wahr. Er versank förmlich in seinem Buch, schien nur noch körperlich anwesend. Nach einiger Zeit schrak er abrupt auf und trank von seinem Bier. Irgendwann stand er widerwillig auf und ging zur Toilette. Widerwillig richtete er sich auf und ging davon. Das Buch lies er liegen. Da lag es vor mir. Ein von tausend besessenen Fingern geprägtes Artefakt fremder Identität, bis zum bersten angefüllt mit Hingabe. Ich betrachtete es. Es sah mich fordernd an. Es schien meinen Blick an sich zu reißen. Zitternd lief mir ein kurzer Schauer über den Rücken, als ich beobachtete wie meine gierige Hand nach ihm griff. Ich spürte meine Chance und griff schnell, beschämend ungeniert, nach dem zugeklappten Buch. Nur einen kurzen Blick, dachte ich mir. Ich musste es haben. Ich blätterte hastig darin. Es war beschrieben mit unleserlichen, verwaschenen Bleistiftzeilen. Hier und da waren kleine Skizzen und es gab auch ein paar Aquarelle. Ich sah seltsame Augen auf goldene Mauern gemalt, bunte Wimpelketten, Wolken und düstere Wälder. Da waren wunderbare Gesichter, fremdartig, Männer, Frauen und Kinder in Lumpen und zerfallenen Hütten. Sehr, sehr feine Linien und sorgfältige Schraffuren. Was für Blicke waren das! Zauberhaft! Es waren Asiatische Augen. Lebendig blickten sie aus der weißen Leere des Papiers. Doch die meisten Bilder zeigten einen gewaltigen Berg. Er war ungewöhnlich genau gezeichnet. Als dunkle Silhouette ragte er in den Himmel, weit hinauf durch Wolkenbänder und schneebedeckte Felsenwälle. Alle Kanten, alle Flächen hatte er plastisch ausgearbeitet. Ich spürte die Macht und Größe des Berges. Wirbelnde Striche und Schraffuren, wild und abweisend, ein Riese. Schroff und majestätisch. Doch etwas war sonderbar. Den höchsten Gipfel der Bleistiftzeichnung hatte er scheinbar hastig mit signalroter Aquarellfarbe übermalt. Sie war so strahlend rot, dass das feine Silbergrau der Linien mit dem schmutzigen Weiß, des welligen, wohl einstmals nass gewordenen Papiers, zu einer einzigen blassen Fläche verschmolz. Und aus dieser stach der rote Fleck ins Auge, wie eine Wunde. Warum hatte er das getan? Wieso zerstörte er seine Bilder auf diese Weise? Verschmiertes Rot? Rot wie Blut, wie Gefahr? War dieser Mann ein Bergsteiger? Welcher Berg konnte das sein?
„Es ist so schwer, sich selbst zu betrachten.“ Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ich erschrak. Voll Scham schlug ich das Buch reflexartig zu. Er war zurückgekehrt, saß mir schattenhaft gegenüber und starrte mir direkt in mein Gesicht. Blitzartig schoss mir heißes Blut in den Kopf. Ich fühlte mich ertappt. Eine finstere Wand. Alles Dunkel drohend auf mich gerichtet. Der gesamte Raum verschwand in diesem Moment.
„Ich hatte es wohl liegengelassen.“ Ein feines Lächeln zog über sein entrücktes Antlitz, als er meine verzerrten Lippen sah.
„Es tut mir Leid, wissen Sie, Ich weiß auch nicht was in mich gefahren ist.“, stammelte ich, „Es tut mir wirklich leid…“
„Ich weiß!“
„Was?“ fragte ich verdattert, noch immer schamrot im Gesicht.
„Was in dich gefahren ist.“ antwortete er.
Ich sah ihn ungläubig an. Was war das für ein seltsamer Mensch? Ein Moment der Stille.
Langsam nahm er das Buch an sich. Jetzt wirkte er plötzlich viel wärmer.
„Mein Name ist Robert.“ Er reichte mir die Hand. Erlöst ergriff ich sie.
„Angenehm. Ich bin Sebastian, das sind wirklich wunderbare Bilder.“
Er sah mir unvermittelt in die Augen, als ob er eine Antwort darin suchte.
„Es sind keine Bilder, das ist alles, was von mir übrig ist.“ Stille. „Weshalb sitzt Du allein hier?“ fragte er endlich.
„Nur so.“ Ich überlegte verwirrt. „Und Du?“
„Weißt Du welcher Berg das ist?“ Er schmunzelte in sich hinein als er mich nach Luft schnappen sah. „Ich muss wohl ziemlich lange weg gewesen sein. Sein Name ist Chomolungma, oder Sagarmatha, oder Mount Everest. Je nachdem. Such dir einfach einen Namen aus.“ Er lächelte seltsam. „Interessierst Du dich für Märchen, Sebastian?“
Märchen? Die blasse Erinnerung an diffuse Kindertage stieg in mir auf. „Ich weiß nicht“, sagte ich etwas verwirrt. Er fixierte mich. Sein Blick schien mich gefangen zu nehmen. Er kontrollierte mich.
„Was weißt Du über das Fremde?“.
Das Fremde? Märchen? Was waren denn das für Fragen? Es ging doch eben noch um Berge? Meinte er vielleicht den Zauber von Kindheitserinnerungen? Oder alte romantische Geschichten. Was sollte ich darüber wissen? Das Fremde…? Läuft das Fremde immer davon? „Das Fremde läuft immer davon“ antwortete ich spontan.
Sofort starrte er mich an. Seine Augen waren jetzt wie gleißende Monde, nichts neben sich duldend, alles herum in Nacht verwandelnd. Ich versank fast unter diesem Blick. Dann verwandelte er sich in ein Kind.
„Es tut mir leid“, klang es abwehrend.
Meine Antwort schien ihn getroffen zu haben. Er strich sich mit der Hand über den Kopf und blickte unruhig umher. Zum ersten Mal, wie es mir vorkam, sah ich ihn sich bewegen. Er winkte dem Kellner zum zahlen. „Was ist mit diesem Berg?“ rief ich hastig.
Er reagierte nicht.
„Was ist dort passiert?“
„Woher willst Du wissen, dass ich dort gewesen bin?“
„Ich habe es in deinen Zeichnungen gesehen.“
„Weißt Du etwa, was es bedeutet, irgendwo zu sein?“ höhnte er sarkastisch. Verborgener Schmerz lag in seinen Worten.
„Es war eine ganz einfache Frage, du musst mir darauf nicht antworten“, sagte ich und versuchte zu lächeln. Er schwieg. Unendliche Minuten verstrichen bis der Wirt kam. Aber anstatt zu bezahlen bestellte er eine neues Bier. Ich war durcheinander. Er zog sein Buch hervor, schlug es auf und begann vorzulesen.
„Es hat angefangen zu schneien. Der Blick aus dem Fenster verliert sich im rasenden Strudel weißer Flocken, die um die Schwärze des Abends einen grauen, wirbelnden Eistunnel blasen. In der Ferne schimmern rötliche Lichter aus der verschwundenen Stadt. Wir sitzen auf einem anderen Stern. Der rastlose Wind faucht um die Ecken und Kanten der Häuser, als ob er alles abrunden möchte, alles Schroffe mit knirschendem Schnee aufzulösen. Die Fensterläden knarren leise. Unten, wo unser Licht gerade noch hinstrahlt, bewegen sich dunkle Schatten. Wandernde Felsen in der Nacht. Schnee formt pappig graue Zotteln um ihre Leiber, aus denen spitze Hörner ragen. Bald schon werden sie von den Flocken begraben sein und erst am Morgen wieder auferstehen – als neue Wesen aus dem Schnee erwacht. Die Yaks rühren sich nicht mehr. Sie schlafen. Sie warten auf den neuen Tag. Wie ein Bild aus einer dunklen Ewigkeit. Ohne Sie wäre niemand hier…“
Er las und las. Ich wagte nicht zu sprechen und lauschte. Das Kerzenlicht zog lange, rotbraune Schatten von uns weg. Ich zuckte zusammen, als ein kleiner nasser Fleck auf meinem Arm erschien. Noch einer und noch einer. Eiskalt glitzernd auf meiner Haut. Funkelnde Flocken rieselten um uns herab und verschwanden lautlos zu Boden. Reifkristalle glänzten an der Kerzenflamme und Eisblumen überzogen unsere Gläser. Alle Geräusche verschwanden. Robert sah aus wie ein schwarzer, schneebedeckter Felsen. Er wurde voll und ganz zu dem, was er las. Ich versank in der Tiefe seiner Worte.
Ich weiß nicht mehr wie lange wir dort saßen. Irgendwann kam der Wirt, wischte allen Winter weg. Es war schon fünf Uhr morgens. Robert las ungerührt. Ich unterbrach ihn und er schrak hoch und klappte das Buch zu. Beim Geräusch der zuschlagenden Seiten sackte er in sich zusammen. Müde nahm er seine Jacke an, ging zum Tresen und bezahlte die Rechnung. Ich sah ihn von der Seite, dem Wirt zugewandt. Eine dunkle Gestalt, die im dämmrigen, von Kerzen und Zigarettenrauch gedämpftem Licht seltsam zu schimmern, ja zu glänzen schien, wie ein nasser, aufgetauter Stein am Feuer. Er sprach etwas zum Wirt hinter der Bar und dieser antwortete freundlich und gelassen. Ich kam mir auf einmal vor wie ein Zuschauer im Theater. Die Zwei standen dort wie auf einer Bühne. Eigentlich ein belangloses Gespräch. Doch nichts, überhaupt nichts schienen diese beiden Menschen dort gemeinsam zu haben. Genauso wenig wie ich mit ihnen. Zum ersten Mal fühlte es sich an, als ob mich jemand in meine Umgebung hineingeklebt hätte. Ich fühlte mich seltsam fremd in dieser eigentlich alltäglichen Szene. Das Geschehen zog an mir vorbei, als ob ich nicht mehr dazu gehörte. Ich sah dem Wirt beim rechnen zu und ahnte dabei seine Gedanken. Gedanken aus meiner Heimat. Ich sah sie von außen. Robert kam von ganz woanders her. In dieser Welt hier war er nur noch Gast. Welches Elend verbarg sich hinter seinen eisig strahlenden Augen? Nahm er uns überhaupt als Seinesgleichen wahr? Wie konnte die Blicke des Wirtes ertragen, Blicke, die versuchten in ihm einen von hier zu erkennen – jemanden der hierher gehörte. Doch das konnte dieser Mann dort nicht mehr. Das spürte ich genau. Ich sah ihn und sah dabei den roten Berg in seinem Buch. Er war nicht wirklich hier. Ich war nicht wirklich hier. Einen Moment lang durchfuhr mich große Einsamkeit. Ich war froh, dass Robert nicht zu mir herüberschaute.
Als wir die Wirtschaft verließen, dämmerte der Morgen rosa über der schlafenden Stadt. Er ging in Richtung Domplatz. Nach einigen Schritten blieb er stehen.
„Ich möchte die Geschichte gern zu ende hören“, sagte ich.
In genau in diesem Moment glaubte ich ein Zwinkern in seinem rechten Augen zu erkennen. Ein leises Lächeln. Er las meine Gedanken. Ich spürte wie mich eine große, ahnungsvolle Kraft überkam. In diesem Mann lag etwas von mir verborgen, etwas von uns allen. Eine Sehnsucht, die wir nicht verstehen können, weil sie nicht zu verstehen ist. Seid wann war ich schon auf der Suche danach, wie lange war das schon so gewesen? Wie lange fand ich immer nur Fragmente? Meine Augen waren auf einmal schrecklich schwer und müde. Meine Kraft war aufgebraucht. Ich blickte auf, doch Robert war schon losgegangen und verschwand um die nächste Häuserecke. Weg war er. Aufgelöst im roten Licht des lauen Morgens. Zuhause angekommen versuchte ich sein Gesicht zu zeichnen.
Am 20. Juni 2007 erhielt ich ein kleines Päckchen. Der Absender fehlte, doch wusste ich, von wem er kam. Darin fand ich einen Stoß sorgfältig beschriebener Seiten und etwa dreißig Farbfotos. Es war das Vermächtnis des Robert S. Brabast.
„Sebastian, ich schicke Dir meine Geschichte. Ich weiß, dass Du darin etwas finden wirst. Ich spüre es. Ich muss fort von hier. Halte dich fern von mir. Viele Grüße, Dein Robert“